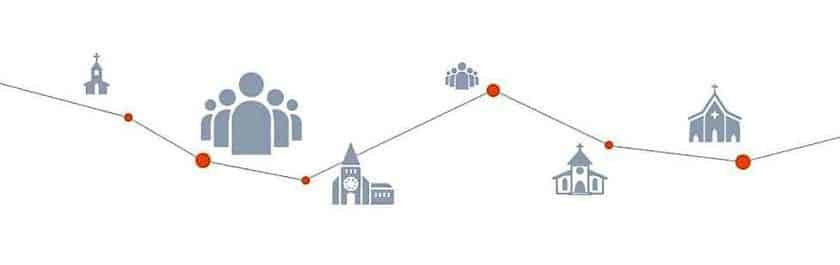Bild von Kerstin Meinhardt.
Generalvikariatsrat Dr. Christian Hennecke (56) ist Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Bistum Hildesheim. Zuvor war er für die Priesterausbildung verantwortlich. Er kennt die Gemeindesituation auch aus seiner Zeit als Pfarrer. Für die Zeitschrift Franziskaner sprach er mit Bruder Stefan Federbusch zu den gegenwärtigen Überlegungen, kreativen Ideen und Neuaufbrüchen in den Gemeinden im Blick auf die Kirche der Zukunft.
Der Begriff der „Lokalen Kirchenentwicklung“ wurde im Bistum Hildesheim 2011 entwickelt, um einer neuen Kultur des Kircheseins den Weg zu bereiten. Im Blick auf die Volk-Gottes-Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils geht es um eine „Kirche der Beteiligung“. Was ist damit konkret gemeint?
Schon vorher waren wir auf einem Entwicklungsweg, dessen Tiefe wir aber erst Schritt für Schritt entdeckt haben. Bei Studienreisen nach Südafrika, Indien und auf die Philippinen lernten wir viel über die Kleinen Christlichen Gemeinschaften, aber wir verstanden erst nach und nach, dass es nicht zuerst um die Bildung neuer Gemeindeformen geht, sondern um ein neues Grundparadigma: Kirche ist und lebt aus der gelebten Grundberufung der Getauften, Kirche ist und lebt aus der Gegenwart Gottes mitten unter uns – und weil er an unserem Leben teilhat, werden wir Kirche. Kirche ist und wird, wenn sich Christen einlassen auf ihre Zeitgenossen. Und so ist Kirchenentwicklung immer ein geistvolles Geschehen der Inkulturation und Kontextualisierung, die alle Menschen einbeziehen will. Und so ist Kirchenentwicklung immer lokal, und bringt immer wieder neue Formen und Weisen den Kircheseins hervor, transformiert bestehendes, und bereitet Neuem dem Weg. Man könnte sagen: die „Formen“ der Kirche, etwa lokale Gemeinschaften oder fresh expressions, das sind die Blüten, Lokale Kirchenentwicklung ist hingegen der Wachstumsweg.
Gibt es ein (Lieblings-)Bild, das Ihnen bei Lokaler Kirchenentwicklung in den Sinn kommt und das das Gemeinte anschaulich macht?
Ich habe zwei Lieblingsbilder, um den Wandel deutlich zu machen: zum einen fällt mir das Bild vom Kaleidoskop ein. Wir sind in einem Umwandlungsprozess, der manchmal bedrohlich wirkt, aber: in Wirklichkeit konfiguriert sich unsere gesamte Tradition neu und wird ein neues farbiges und strahlendes Bild. Das ist spannend und macht mich sehr erwartungsfroh. Auf der anderen Seite „steht die Kirche Kopf“: Über Jahrzehnte hinweg, auch nach dem Konzil, haben wir uns daran gewöhnt, Kirche von ihren Strukturen her zu fassen. Das tun wir heute auch noch – und verwechseln dabei Kirchenentwicklung und Strukturentwicklung. Die Dominante war und ist in vielen Diskussionen immer die Frage um Geld, Personal und Größe der Pfarreien. Aber zu sagen ist auch: gerade damit sind wir nicht weitergekommen, und es ist auch ein Fehler zu meinen, dass Kirche dadurch besser ist. Eine Kirche auf dem Kopf wäre also eine Kirche, die strickt von den Geistenergien her denkt, die im Volk Gottes wirken – und die Institution ermöglicht, befeuert, unterstützt und begleitet dieses Wirken und verknüpft es in der Einheit in Vielfalt (und so sakramental). Im (dritten) Bild gesprochen: sie ist jetzt nicht mehr begrenzender Rahmen, sondern tragendes Skelett.
Pfarrer Hennecke, Sie haben als Leiter der Hauptabteilung Pastoral zusammen mit Christiane Müßig, Referentin für Lokale Kirchenentwicklung, innerhalb von zwei Jahren alle 119 Pfarrgemeinden des Bistums Hildesheim besucht. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
Wir sind noch nicht fertig. Hinter uns liegen 72 Pfarreibesuche von 119. Es ist eine beeindruckende Erfahrung. Auch in den kleineren Pfarreien, aber eben auch in den großen Pfarreien gilt: sie haben erstaunliche Stärken und viel Energie ist spürbar. Natürlich befinden sich alle Pfarreien in einem Wandel und werden durch die kleiner werdende Zahl von Priestern herausgefordert. Da kann es leicht passieren, dass man – siehe oben – räsoniert. Aber mir fällt auch auf, dass vor uns noch viel Neuland liegt: oft ist die gegenwärtige Glaubenssituation noch nicht wirklich reflektiert, oft geht es noch darum, ein bestehendes Modell zu optimieren – und oft ist da eine getrübte Sehschärfe. Denn die Chancen für die Entwicklung der Kirche vor Ort sind riesig, wenn man bestimmte scheinbar unverrückbare Standards hinter sich lässt: wieso dürfen nicht neue Gemeinden entstehen? Wieso müssen alle zum Sonntagsgottesdienst, wo doch die meisten Menschen erst anfangen, ihren Glauben zu entdecken? Ist es denkbar, dass Gottesdienste nicht am Sonntag zwischen 9 und 11 sein müssen? Können wir uns damit anfreunden, dass eine nächste Generation von Christen neue Gemeindeformen braucht? Entdecken wir den Reichtum anderer kirchlicher Orte als Segensorte? In jeder Pfarrei sind Menschen, die sich auf die Perspektive einschwingen, und mit denen werden wir weiter in Verbindung bleiben. Insgesamt merkt man aber, dass eine Vision fehlt – und die Instrumente, einen Entwicklungsprozess zu gestalten. Das gilt gerade auch für die Hauptberuflichen und Priester, die oft ganz anders geprägt sind. Ging es nicht immer um Bestandswahrung? Die neuen Perspektiven verlangen ihnen allen auch ein massives Umdenken ab.
Aus der Weltkirche (Südafrika, Philippinen) wurde das Modell der „Kleinen Christlichen Gemeinschaften“ (KCG) übernommen. Seit 2004 gibt es ein Nationalteam im deutschsprachigen Raum, dem Sie aktuell angehören. Gelingt es, dieses Modell in Deutschland in die Gemeinden einzupflanzen?
Man kann nicht einfach die Früchte aus dem Süden importieren. Wir sind außerdem im Norden Europas in einer postmodernen Kultur, und entsprechend braucht es eine Einsicht in die Kultur, die hinter dem Ganzen steht. Die Rede von der lokalen Kirchenentwicklung und dem Wandel eines Kirchenverständnisses macht aber deutlich, dass das so schnell nicht geht. Unter 10 bis 20 Jahren werden wir die Früchte nicht sehen – das war übrigens auch dort so, wo die Kleinen Christlichen Gemeinschaften entstanden sind.
Sie haben ein Netzwerk Lernpfarreien gegründet, dessen zweites Treffen am 23./24. Juni 2017 in Hildesheim stattfand. Was hat es damit auf sich?
Eines ist in den vergangenen Jahren deutlich geworden: Am besten lernen wir Neues, wenn wir ein Bild davon bekommen, das uns sichtbar macht, wie so was „geht“. Wir haben ja selbst durch unsere weltkirchlichen Reisen genau davon profitiert. Gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass es bereits spannende Aufbruchs- und Prozesserfahrungen in deutschsprachigen Diözesen gibt. Aber wir wissen und lernen viel zu wenig voneinander. Das soll dieses Netzwerk ändern
(www.lokale-Kirchenentwicklung.de/netzwerk).
Wir haben uns auf den Weg gemacht und eine ganz einfache Plattformstruktur gebildet, die sehr offen ist, denn mitmachen können die Pfarreien, die miteinander lernen wollen. Einmal im Jahr ist ein gemeinsames Austausch- und Lerntreffen. Und in diesem Jahr gibt es zwei geführte Wochenenden nach Duderstadt und Oberursel. Dankbar bin ich dafür, dass dieses Netzwerk von einer Stiftung getragen wird, die es ermöglicht, dass Engagierte Christen ohne Kosten mitmachen können. Ziel ist es, mit immer mehr Pfarreien in eine gemeinsame Lernbewegung zu kommen.
Aktuell gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen: die Tendenz zu immer größeren (Pfarrei-)Einheiten und die lokale Kirchenentwicklung. Wie stehen diese Entwicklungen zueinander, ergänzen sie sich in einer konstruktiven Spannung oder kommt es zu starken Reibungsverlusten?
Ich meine, dass das zwei unterschiedliche Entwicklungen sind, die nur dann kontrastieren, wenn man Strukturentwicklung und Kirchenentwicklung miteinander verwechselt: Der Kirchenentwicklung geht es um die Frage, wie Christen vor Ort die Sendung des Evangeliums leben und gestalten und so Kirche werden kann, in der Unterschiedlichkeit gewachsener und neuer Formen. Die Bildung größerer Pfarreien beschreibt den stützenden und unverzichtbaren strukturellen und theologisch-sakramentalen und auch rechtlichen Rahmen für diese Entwicklung. Das fordert vor allem denen etwas ab, die Verantwortung tragen. Es geht um einen tiefgreifenden Rollenwandel. Die pastoralen Hauptberuflichen, Diakone und Priester werden immer weniger fixiert auf „Gemeinden“ sein, sondern auf die vielfachen Gestalten der Kirche, Gemeinden, Einrichtungen, neue Formen … Ihnen dienen sie in ihrem Dienst. Im Fußballbild gesprochen: Die Priester und alle pastoralen Berufe werden vom Spieler zum Trainerteam.
Da es bei lokaler Kirchenentwicklung nicht um weitere Strukturprozesse geht, sondern um persönliche Berufungswege, kommt es zu einer Vielfalt von kirchlichen Sozialgestalten. Glauben Sie, dass es in dieser Vielfalt ein verbindendes Element im Sinne eines Netzwerkes geben wird oder besteht nicht die Gefahr, dass die „neuen (Kirch-)Orte“ singulär nebeneinander her bestehen, ohne dass die konkreten Menschen der einzelnen Gruppen in Kontakt miteinander sind?
Das Verbindende ist ja Christus. Er ist die Mitte auch der unterschiedlichsten Kirchengestalten. Zunächst mal ist das wesentlich, weswegen die Frage der Vernetzung daraus folgt. Konkret heißt das: es gilt die Berufung und Sendung in Christus zu stärken, das ist die erste Aufgabe – und dann wird deutlich, dass es eines guten Dienstes der Einheit braucht, der Vielfalt schützt und Verbindung ermöglicht. Ich habe da wenig Sorge: das Evangelium ist nicht sektierisch, sondern sucht Verknüpfung.
Viele stehen den Großpfarreien äußerst skeptisch gegenüber …
Ich kann die Skepsis gut verstehen, vor allem dann, wenn es darum gehen sollte, irgendwie ein bestehendes Pastoralgefüge einfach nur noch ein wenig zu weiten. Und das geht nicht mehr. Ich kann diese Skepsis auch verstehen, wenn im Hintergrund noch die Idee der „einen Gemeinde“, der „Pfarrfamilie“ steht und so Zentralisierungs- und Integrationsideologien pastoraler Art mitschwingen – oder wenn weiterhin Kirche mit den institutionellen Rahmenbedingungen, die ihrerseits sakramententheologisch begründet sind, identifiziert werden. Wenn man also nicht im Denken und Handeln neu wird, dann kann man das Ganze nur als Abbruch deuten.
Die Pfarrei bleibt mir aber wichtig. Denn wenn immer mehr Gemeinden sich einlassen auf die „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen“ (GS 1) und von hier aus Kirche in neuer Weise wächst, und wenn neue Kirchenkristallisationen entstehen, und Menschen gemeinsam Aufbruch gestalten, dann braucht es mehr als bisher die Kraft der Quelle, die Verbindung mit dem Ursprung und der Tradition, und die Einheit und Verbundenheit mit der ganzen Kirche. Dann braucht es die Ermöglichung des Glaubenswachstums, dann braucht es den Dienst an der Einheit. Dafür steht die Pfarrei und ihre Mitarbeiter und vor allem der Pfarrer. Dann ändert sich allerdings die Rolle sehr – man kann fast sagen: sie wird episkopaler: aber genau mit einer bischöflichen Sendung sind ja pastorale Mitarbeiter unterwegs und damit gerufen, Orientierung zu geben, Konflikte zu versöhnen und so die Apostolizität zu vergegenwärtigen, vor allem aber, in Verkündigung und Sakramenten sichtbar zu machen, dass Kirche immer aus der Gnade lebt.
Wie reagieren die Hauptamtlichen auf die Herausforderung, ihr berufliches Profil, ihre Rolle zu verändern?
Sie reagieren verunsichert. Es wäre merkwürdig, wenn das nicht geschähe. Es geht nicht nur um eine veränderte Perspektive auf das Wachsen und Werden von Kirche und Christen, sondern eben auch – vor allem auch – um eine neue Weise, den eigenen Dienst zu verstehen. Es geht um ein „Umparken im Kopf“, um ein Einüben von neuen Haltungen.
In mehreren Bistümern wie Hildesheim oder Osnabrück werden Teams aus Laien mit der Gemeindeleitung beauftragt. Welche ersten Erfahrungen können Sie nennen?
Auch viele andere Bistümer sind hier unterwegs, durchaus auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Auf der Ebene der deutschen Seelsorgeamtsleiter versuchen wir gerade, diese verschiedenen Perspektiven gemeinsam zu sichten. Wie immer aber man dies gestaltet, ob über die Leitung der Pfarrei nach §517,2 oder über Gemeindeteams innerhalb von Pfarreien – spannend ist der Prozess, den es dafür braucht. Es sind so viele engagierte Christen auf dem Weg, aber das Risiko ist natürlich, einfach das Bekannte zu wiederholen und einen „Orgakreis“ aufzubauen. Wer mehr möchte, braucht einen längeren Anweg, auf dem die ganze Gemeinde vor Ort mitgenommen wird. Bevor Teams entstehen, die Leitung vor Ort verantworten, steht auch die Frage, ob es als „Ersatz“ für fehlende Hauptberufliche oder als Chance aufgrund von notvoller Veränderung gesehen wird, die aus der Einsicht in die Kraft und Energie der Taufe, in die Potentiale des gemeinsamen Priestertums und seiner Reichweite gesehen wird. Auch hier gilt: es reicht nicht, einfach nur das bisherige mit einer neuer Form weiterzumachen.
So sind auch unsere Erfahrungen: es braucht so etwas wie grundlegendes Erlernen von Haltungen: das Hinsehen auf den Sozialraum, die Orientierung an Visionen, die geistliche Verwurzelung. All das wächst nicht von selbst, auch wenn es schon da ist. Es braucht gute Begleitung und Unterstützung, und es braucht orientierende Ordnungen, die eine Transparenz der Prozesse ermöglichen.
Erste Erfahrungen zeigen, dass die wichtigste Frage die sein könnte und sein wird: wie werden die Pastoralteams diese Lokalen Leitungsteams initiieren und begleiten.
Lokale Kirchenentwicklung fördert Vielfalt. Sollten die Bistümer eher einen gemeinsamen Weg gehen oder jedes Bistum spezifisch für sich diesen Suchprozess gestalten?
Das ist keine Frage. Faktisch gehen alle Bistümer einen je eigenen Weg, und man kann staunen, wie unterschiedlich das ist. Das hängt mit den Erfahrungen und Wegen zusammen, die ein Bistum gegangen ist und geht. Dabei wird man allerdings nicht außeracht lassen können, wie stark im vergangenen Jahrzehnt ähnliche Impulse überall Wirkung zeigen. Die Erfahrungen der Pastoralentwicklung in den Philippinen haben großen Einfluss und bezeugen, dass weltkirchliche Player Bedeutung gewonnen haben. Aber auch die Initiativen des ZAP in Bochum, und anderer Player – man denke an die Strategiekongresse in Köln oder Kirche hoch2 in Hannover haben wichtige Impulsschneisen geschlagen. Und dabei geht es zuerst um Haltungen und ein „Framework“ visionärer Pastoralprozesse. Und so kann es kaum verwundern, dass die Grundhaltungen und Grundwerte der Entwicklung überall ähnlich sind – dann aber spezifische Suchprozesse beginnen.
Inwieweit hat lokale Kirchenentwicklung (gerade auch in einem Diasporabistum) ökumenische Akzente? Gibt es so etwas wie eine „postkonfessionelle Perspektive“?
Ich denke, dass zum einen die evangelischen Geschwister dieselben Herausforderungen haben wie wir. Und in den vergangenen Jahren haben wir dies erfahren können – vor allem auch im Kontext von Kirche¬hoch2, einer ökumenischen Plattform des Bistums Hildesheim und der Evangelischen Landeskirche Hannover (www.kirchehochzwei.de). Gemeinsam sind wir da auf dem Weg. Und zugleich zeigt sich, dass in den konkreten Ortssituationen gerade im Blick auf die gemeinsame Sendung Ökumene ohne Alternative ist. Aber umgekehrt gilt ja auch: Viele Menschen verhalten sich schon jetzt crosskonfessionell. Und ich glaube, das bedeutet zweierlei: Wir sind gerufen, mehr aus der eigenen Identität und Tradition zu leben, damit wir erkennbar bleiben – und zum anderen werden wahrscheinlich vielfach auch ökumenische Gemeindeformen entstehen. Das bringt viele Fragen, aber auch hier gilt: Wir dürfen unsere eigene Tradition neu entdecken. Ich denke, es läuft auf eine postkonfessionelle Ökumene der verschiedenen Traditionen und Kirchengestalten hinaus.
Wie sieht Ihre persönliche Vision von Kirche für die nächsten fünf bis zehn Jahre aus?
Ich erlebe diese Zukunft an vielen Orten, allerdings glaube ich auch, dass der Umbruch und der Abbruch des Gewohnten sich beschleunigen werden. Aber in all meinen Besuchen erlebe ich, mit wie viel Energie und Geistkraft Kirche gestaltet wird. Ich glaube, dass im nächsten Jahrzehnt viel daran hängt, ob wir ein zukunftsoffenes und verheißungsorientiertes Sehen lernen. Mich ärgert die Strukturfixierung, und mich ärgert die Mangelobsession, denn sie ist sehschwach und glaubensschwach. Ich glaube, wir dürfen Kirche weiter „sehen“ als Gemeinden, wir können entdecken, welche neuen Wege der Geist Gottes geht. „Seht, ich schaffe Neues, merkt ihr es nicht?“ Die Umkehr der Sehgewohnheiten wird helfen, Kirche neu zu entdecken, die eigene Sendung zu schärfen und Neues zu wagen. Zugleich wird sicherlich auch einiges sterben. Aber das gehört zu jeder Zeit dazu, ist es doch das Geheimnis unserer Kirche.